Sicher zur MPU:
Strategien, die wirklich helfen
Hier sind Sie richtig: Mit erfahrener Führung schaffen Sie auch einen schwierigen Weg zur positiven MPU. In über 15 Jahren habe ich viele hundert MPU-Kandidaten erfolgreich zum Ziel begleitet.
Das finden Sie hier:
- Was "sicher zur MPU" wirklich bedeutet
- Der Zweck der MPU
- Die MPU verstehen
- Selber aktiv werden!
- Aufbau und Funktionsweise der MPU
- Die Verhaltensanalyse
- Begutachtung oder Prüfung?
- So klappt es zuverlässig
- Die entscheidende Besonderheit
- Angst vor der MPU überwinden
- Das richtige Verhalten bei der MPU
- Eine häufige Einstiegsfrage: Warum sind Sie hier?
- Eine künstliche Story lernen?
- Du sollst nicht merken…
- Professionelle Vorbereitung
- Anspruch und Wirklichkeit der MPU
- Wahrheit ist Trumpf - oder sehe ich das falsch?
Wenn Sie verstehen, worum es bei der MPU geht und was genau geprüft wird, können Sie sich gezielt und ohne Angst vorbereiten.
1. Was "sicher zur MPU" wirklich bedeutet
- "Sicherheit" bedeutet nicht Garantie
Wer 100 % Sicherheit des Bestehens der MPU verspricht, ist unseriös. Die MPU ist eine anspruchsvolle Einzelfall-Begutachtung und keine Abfragung auswendig gelernter Vorgaben. Man kann deshalb nie mit absoluter Sicherheit ausschließen, dass bei einem unglücklich verlaufenen Gespräch Restzweifel bleiben. - Gutachter erkennen auswendig gelernte Antworten
Der MPU-Gutachter macht seinen Job nicht erst seit gestern und ist gewohnt, dass er angelogen wird und eine "Story" präsentiert kriegt. Meistens genügen wenige gezielte Nachfragen, um den Luftballon platzen zu lassen. - Vorbereitung muss individuell sein
Sie MPU ist eine Einzelfall-Analyse. Gruppenkurse können nicht detailliert auf den Einzelfall eingehen und taugen nicht zur MPU.Vorbereitung.
Wie Gutachter bewerten und warum viele trotz Vorbereitung scheitern, erkläre ich hier ausführlich:
So sieht effektive MPU-Vorbereitung aus:
- Fangen Sie frühzeitig an mit der Vorbereitung. Sie werden spüren, wie die Angst vor der Begutachtung mit jeder einzelnen Sitzung weniger wird und ein klarer ROTER FADEN entsteht, an dem Sie bei der MPU das Gutachtergespräch festmachen können.
- Spreu vom Weizen trennen! - Natürlich können viele Einflüsse eine Rolle gespielt haben für das Entstehen des problematischen Verhaltens, das schließlich zur MPU geführt hat. Der Gutachter hat aber nicht endlos Zeit. Er erwartet deshalb von Ihnen, dass Sie herausgearbeitet haben, wo das entscheidende Problem lag.
- Bei meinem MPU-Coaching steht die Konzentration auf das Einzelgespräch mit dem psychologischen Gutachter ganz klar im Vordergrund. Es werden keine bösen Überraschungen mehr auf Sie warten, so dass Sie angstfrei in die MPU gehen können.
2. Der Zweck der MPU
Die MPU dient nicht dazu, jemanden zu bestrafen. Sie ist eine Chance zur Klärung: Was ist passiert – und wie lässt sich sicherstellen, dass es nicht wieder vorkommt?
Die MPU soll zeigen, ob Sie Ihr früheres Verhalten verstanden und dauerhaft verändert haben.
Sie ist kein Urteil, sondern eine Gelegenheit, Vertrauen zurückzugewinnen – bei der Behörde, aber auch bei sich selbst.
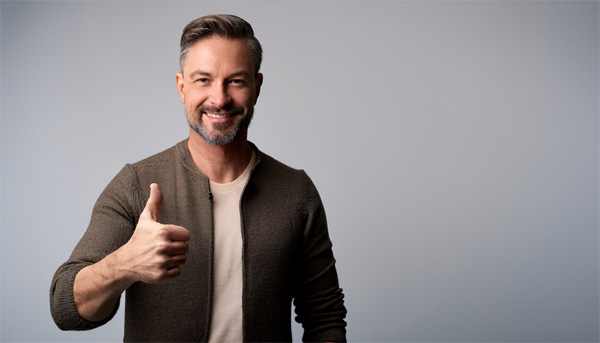
3. Die MPU verstehen
Ziel ist es, solche Verkehrsteilnehmer herauszufiltern, die ein Verhalten an den Tag gelegt haben, das eine ganz erhebliche Gefährdung für die übrigen Verkehrsteilnehmer bedeutet. Die MPU soll Gelegenheit bieten zu belegen, dass man sich so weit maßgebend verändert hat, dass man jetzt keine Gefährdung mehr darstellt.
Lesen Sie auch hier:
Die Führerscheinstelle legt fest, welche Fragestellung genau untersucht werden soll. Möglich sind auch Mehrfach-Fragestellungen (z.B. Alkohol und Verkehrsdelikte, weil der Kandidat betrunken ohne Führerschein unterwegs war).
Unbedingt beachten:
- Lassen Sie das Gutachten nur an sich selber senden, nicht auch gleich an die Führerscheinstelle! Falls es nämlich negativ ausfallen sollte, sollten Sie das nicht bei der Führerscheinstelle abgeben!
- Unterschreiben Sie auch keine Schweigepflicht-Entbindung! Falls das auf dem Vordruck der Führerscheinstelle drauf stehen sollte, auf dem Sie erklären mit der MPU einverstanden zu sein, dann streichen Sie diese Passage durch!
Gute Vorbereitung ist entscheidend
Auswendiglernen ist so ziemlich das Schlechteste, was Sie tun können. Der Psychologe macht seinen Job nicht erst seit gestern und würde das sofort merken. Er würde ein paar genauere Nachfragen stellen, und schon gehen Ihnen die so schön auswendig gelernten Antworten aus.
Ganz wesentlich ist, dass Sie erkannt haben:
- Sie haben andere Verkehrsteilnehmer durch Ihr Verhalten gefährdet. Das soll verhindert werden.
- Die MPU soll Ihnen Gelegenheit geben den Gutachter zu überzeugen, dass Sie sich grundlegend geändert haben.
- Die MPU ist eine Begutachtung und keine klassische Prüfung wie z.B. die Theorieprüfung bei der Fahrschule. Eine Begutachtung ist viel stärker auf den individuellen Einzelfall bezogen.
Der Gutachter muss am Ende eine Prognose über Ihr künftiges Verhalten abgeben. Dafür ist er an enge Vorgaben gebunden. Eine positive Prognose ist nur dann möglich:
- Sie haben alles gründlich aufgearbeitet und können klar erklären, wieso es zu Ihrem problematischen Verhalten im Straßenverkehr gekommen ist.
- Die damaligen Voraussetzungen dafür bestehen jetzt nicht mehr.
- Sie haben ganz reale Veränderungen durchgeführt, durch die das Problemverhalten dauerhaft abgestellt wurde.
- Sie haben geeignete Maßnahmen vorgesehen, mit denen verhindert werden kann, dass es zu einem Rückfall kommt.
Typische Fehler vermeiden
- Verharmlosen des Fehlverhaltens
Als Betroffener erlebt man das eigene Verhalten ja aus einer sehr subjektiven Perspektive. Man tendiert zu einer Sichtweise wie "ich hab einfach Pech gehabt", "es bestand keinerlei Gefahr" o.ä. Der Gutachter würde das aber sofort als mangelnde Einsicht in die Problematik bewerten. - Lügen oder Widersprüche
Natürlich kann der Gutachter nicht alles wissen. Es ist aber dringend davon abzuraten von der Wirklichkeit merklich abzuweichen. Die meisten Kandidaten unterschätzen die Gefahr sich zu verplappern stark. Der Gutachter ist gewöhnt, dass er fast ständig angelogen wird. Er hat deshalb ein sehr feines Gespür dafür und verfügt über Fragetechniken, die Sie nicht unterschätzen sollten. - Keine echte Verhaltensänderung
Es reicht nicht einfach nur eine Sammlung guter Vorsätze zu bieten. Handfeste Veränderungen sind gefragt.
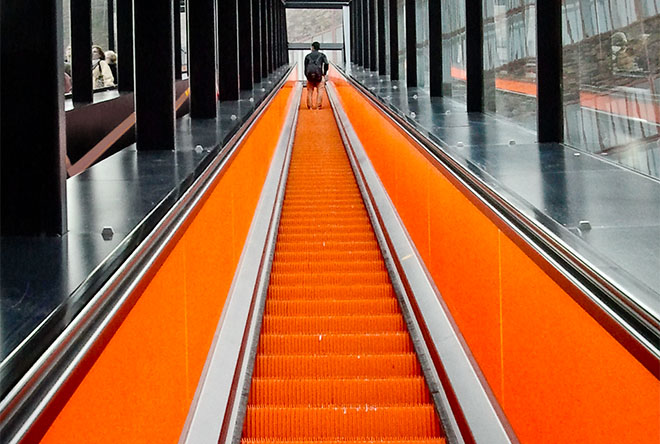
Und oben wartet der Führerschein…
Diese Strategien führen zum Erfolg
- Reflektion
Es ist ganz wesentlich, dass Sie wirklich verstanden haben, was der Auslöser für das Verhalten war, das Sie jetzt zur MPU geführt haben. Nur dann können Sie den Gutachter überzeugen, dass Ihre Aufarbeitung - Detaillierte Aufarbeitung und Veranschaulichungen
Zeigen Sie Gutachter, dass Sie nicht nur oberflächlich gearbeitet haben. - Übungsgespräche
Wir spielen im Detail durch, mit welchen hartnäckigen Nachfragen Sie rechnen müssen und wie Sie darauf am besten reagieren können.
4. Selber aktiv werden!
Es gibt eine ganze Reihe von Fristen bei der MPU, auf die Sie nicht ausdrücklich hingewiesen werden. Dazu muss man gar nicht jemandem eine böse Absicht unterstellen, sondern es sind oft Auswirkungen, die an ganz verschiedenen Stellen ansetzen und deshalb lang unbemerkt bleiben können.
Sie selbst müssen aktiv werden und sich frühzeitig darum kümmern, dass Sie Bescheid wissen, was in Ihrem Fall zu erwarten ist. Vereinbaren Sie mit mir einen Termin für die kostenlose Analyse Ihres individuellen Falls - unkompliziert und flexibel per Videokonferenz:
Meine MPU-Vorbereitung ist genau darauf zugeschnitten, dass Sie mit meiner Hilfe die bei Ihnen statt gefundenen positiven Veränderungen dem Gutachter so präsentieren können, dass sie optimal auf die Beurteilungskriterien passen und zu einer positiven Prognose führen müssen.
5. Aufbau und Funktionsweise der MPU
Die MPU wird nur dort durchgeführt, wo zuvor ein ernsthafter Verstoß gegen die Verkehrssicherheit festgestellt wurde.
Damit Sie wieder fahren dürfen, müssen Sie zeigen, dass sich Ihr Verhalten nachhaltig verändert hat.
Dafür gibt es bundesweit rund 300 zugelassene Begutachtungsstellen. Alle arbeiten nach einheitlichen, wissenschaftlich überprüften Standards. Das garantiert ein faires und nachvollziehbares Verfahren.
Die MPU besteht aus mehreren Teilen, die erst gemeinsam ein vollständiges Bild ergeben:
Medizinischer Teil:
Hier wird geprüft, ob gesundheitliche oder körperliche Faktoren eine Rolle spielen. Das ist meist unproblematisch und dient vor allem Ihrer eigenen Sicherheit.
Reaktionstests:
An einem Computer prüfen Sie Reaktionsvermögen, Konzentration und Aufmerksamkeit. Das sind standardisierte Tests, die niemanden „reinlegen“ sollen, sondern objektive Werte liefern.
Psychologischer Teil:
Hier geht es um Sie als Person – um Einsicht, Verantwortung und Veränderung. Dieses Gespräch ist entscheidend, denn es zeigt, ob Sie Ihr früheres Verhalten wirklich verstanden haben.
Typische Themen im Gespräch sind:
- Was ist damals passiert? Wie kam es dazu?
- Warum haben Sie sich so verhalten?
- Was haben Sie seither verändert?
- Was war Ihre Motivation dafür?
- Wie stellen Sie sicher, dass es nicht wieder vorkommt?
Das klingt einfach – doch eine ehrliche und überzeugende Antwort braucht Vorbereitung und Selbstreflexion.
6. Die Verhaltensanalyse
Der psychologische Teil basiert auf den Erkenntnissen der Lernpsychologie. Diese geht davon aus, dass jedes Verhalten einen inneren Zweck erfüllt – bewusst oder unbewusst.
Wer zum Beispiel zu schnell fährt, tut das meist nicht „einfach so“, sondern weil ein bestimmtes Gefühl oder Bedürfnis dahintersteckt.
Genau das zu erkennen, ist der wichtigste Schritt zur Veränderung.
Gemeinsam mit einem erfahrenen Berater können Sie diese Muster aufarbeiten und neue, bessere Strategien entwickeln.
So entsteht echte Stabilität – nicht durch Zwang, sondern durch Verständnis.
7. Wichtiger Unterschied: Begutachtung vs. Prüfung
Jeder Mensch hat in seinem Leben schon eine ganze Reihe von Prüfungen abgelegt. Allen gemeinsam ist, dass man eine bestimmte Anzahl Fehler machen darf um trotzdem noch bestanden zu haben. Es gibt Unterschiede, aber ein recht guter Richtwert ist es, dass man nur die Hälfte richtig haben muss. In Schulnoten ausgedrückt gibt das dann eine Vier: nicht gut, aber ausreichend.
Unterschied Prüfung / Begutachtung:
Ziel einer Prüfung ist es eine Rangfolge zu schaffen (z.B. von sehr gut bis unbefriedigend). Bei einer Begutachtung wird kontrolliert, ob der Kandidat den Katalog notwendiger Anforderungen erfüllt.
Wo kommen Begutachtungen vor?
Ein typisches Beispiel für eine Begutachtung ist die alle zwei Jahre notwendige HU. Es wird kontrolliert, ob das Fahrzeug alle nötigen Voraussetzungen erfüllt um fahrtüchtig zu sein.
Trotzdem kann es erhebliche Unterschiede geben: So gibt es bei der HU die Unterscheidung zwischen geringe Mängel und erhebliche Mängel. Nur bei erheblichen Mängeln ist eine Wieder-Vorführung nötig und die beschränkt sich auf die gezielte Kontrolle der Behebung der gefundenen Mängel.
Bei der MPU bedeutet "Wieder-Vorführung" immer die komplette neue Begutachtung zum vollen Preis.
8. So klappt es zuverlässig ✓
Das Problem…
- Es geht bei der MPU nicht um Wissensfragen, die man auswendig pauken und irgendwann auch im Schlaf runterbeten kann. Nötig ist eine solide, detaillierte Aufarbeitung der Ursache Ihres gefährlichen Verhaltens. Das ist Vielen nicht klar!
…und die Lösung:
- Ich bin Diplom-Psychologe mit Schwerpunkt Verkehrspsychologie. Ich kenne also die Arbeitsweise der MPU-Gutachter im Detail. Mit meiner Hilfe arbeiten Sie Ihren individuellen Fall so auf, dass keine bösen Überraschungen mehr auf Sie warten.
9. Die entscheidende Besonderheit
Ich hab es ja weiter oben schon angedeutet: Die MPU ist keine klassische Prüfung, sondern eine Begutachtung. Hier zählt nicht die Punktzahl, sondern die Glaubwürdigkeit und Tiefe Ihrer Einsicht.
Der Gutachter prüft zum Beispiel:
- Haben Sie verstanden, warum es damals so kam?
- Können Sie erklären, was sich seitdem verändert hat?
- Wie stellen Sie sicher, dass Sie künftig anders handeln?
Nur wenn alle Fragen nachvollziehbar beantwortet sind, ist die Prognose positiv. Fehlt jedoch ein wesentlicher Baustein, kann der Gutachter keine stabile Veränderung erkennen – und das Ergebnis fällt negativ aus.
Das ist keine Schikane, sondern ein faires, nachvollziehbares Verfahren. Nur wer die eigenen Zusammenhänge wirklich verstanden hat, kann dauerhaft sicher am Straßenverkehr teilnehmen.
10. Angst vor der MPU überwinden
Viele Betroffene empfinden Angst vor der MPU. Das ist völlig normal. Die Medizinisch-Psychologische Untersuchung entscheidet schließlich darüber, ob Sie Ihren Führerschein zurück bekommen. Typische Sorgen drehen sich um das psychologische Gespräch, die medizinische Untersuchung oder die Tests am Computer. Doch die gute Nachricht ist: Mit der richtigen Vorbereitung können Sie Ihre MPU-Angst deutlich reduzieren.

Eine professionelle MPU-Vorbereitung hilft Ihnen Ängste abzubauen, Ihre eigene Geschichte glaubwürdig aufzuarbeiten und souverän zu präsentieren. So gehen Sie mit mehr Selbstvertrauen in die Untersuchung. Auch kleine Techniken wie Atemübungen, positives Denken oder mentale Proben können Ihre Nervosität am Tag der MPU senken.
Fazit: Angst vor der MPU ist menschlich. Mit den richtigen Strategien wird sie zum Antrieb. Je besser Sie vorbereitet sind, desto gelassener und erfolgreicher meistern Sie die Untersuchung.
Wie Sie Ihre MPU-Angst Schritt für Schritt reduzieren
Angst hat man besonders schlimm dann, wenn man nicht weiß, was auf einen zu kommen wird. Genau an diesem Punkt kann man bei der MPU aber sehr gut ansetzen: Durch die Beurteilungskriterien zur Fahreignung ist im Detail festgelegt, wie der MPU-Gutachter arbeiten muss.
Schieben Sie die MPU-Vorbereitung nicht vor sich her. Ich verstehe zwar gut, dass es ein Thema ist, mit dem man sich ungern befassen mag. "Augen zu und durch" ist keine gute Strategie bei der MPU. Wenn Sie sich dem Problem frühzeitig stellen, kann ohne Stress alles aufgearbeitet werden. Kurz vor der MPU machen wir dann noch ein oder zwei Sitzungen, besprechen die aktuelle Lage und simulieren das Gutachtergespräch. Noch vorhandene Schwächen und Unsicherheiten können beseitigt werden und Sie gehen angstfrei in die Begutachtung.
Tipps für den Tag der MPU
Mit meinem direkt auf die MPU-Begutachtung ausgerichteten MPU-Coaching wissen Sie, was im Einzelnen kommen wird. Lediglich die Reihenfolge kann variieren, je nachdem wo gerade als nächstes frei ist. Sie kennen den gesamten Ablauf bereits und können einen Schritt nach dem anderen im Kopf abhaken - erledigt. Das hilft ganz erheblich die unvermeidbare Nervosität zu reduzieren und vor allem Angstgefühle abzubauen.
11. Das richtige Verhalten bei der MPU
Oft werde ich gefragt: "Wie soll ich mich denn verhalten bei der MPU? Ganz normal, oder mit Anzug und Krawatte antreten?"
Ein böses Missverständnis droht
Ich erlebe immer wieder, dass sich MPU-Kandidaten dem psychologischen Gutachter wie einem Therapeut anvertrauen, denn schließlich ist er ja Psychologe. Wer so denkt, der hat die Aufgabenverteilung völlig falsch verstanden: Er soll Sie begutachten, nicht therapieren!
Erwarten Sie nicht, dass Ihnen der MPU-Gutachter "schon irgendwie helfen" wird! Das ist nicht sein Job.
Bedenken Sie:
Sie haben sich durch Ihr Verhalten als eine Gefahr für die Allgemeinheit im Straßenverkehr erwiesen. Der psychologische Gutachter ist der Vertreter der durch Sie gefährdeten anderen Verkehrsteilnehmer. Er will Sie nicht "reinlegen", aber Sie sollten kein Wohlwollen von ihm erwarten ("er wird mir schon helfen…").
Nehmen wir mal an…
…dass Sie sich um eine heiß begehrte Arbeitsstelle bewerben wollen, die Sie unbedingt haben wollen. Ersetzen Sie die Arbeitsstelle durch den Führerschein und den psychologischen MPU-Gutachter durch den Personalchef.
Wie würden Sie sich dabei verhalten? Sie würden natürlich bemüht sein den bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen. Je anspruchsvoller der ausgeschriebene Job ist, um so genauer wird der Personalchef auf Ihre einschlägigen Fähigkeiten schauen. Nur mit Bluffen kommen Sie da nicht weit. Er will Nachweise für Ihre Qualifikationen sehen. Es versteht sich aber von selbst, dass Sie mit dem, was Sie nicht so gut können, nicht gerade hausieren gehen werden, sondern Sie werden alles daran setzen, dass das Bewerbungsgespräch diese wunden Punkte möglichst günstig umschifft. Das gelingt natürlich nicht immer. Deshalb ist es enorm wichtig, dass Sie auf die kritischen Fragen perfekt vorbereitet sind, damit es Ihnen nicht die Sprache verschlägt.
Wie weiter?
Wenn Sie gedanklich bis hierher gefolgt sind, haben Sie einen sehr wichtigen Teil schon verstanden: Sie wissen, warum Sie dem MPU-Gutachter nicht treu-doof Ihr Herz ausschütten und hoffen dürfen, dass ihn Ihre beteuerte Reue ("nie wieder, großes Indianerehrenwort!") schon beeindrucken wird.
Der MPU-Gutachter muss erkennen können, dass eine echte tief gehende Aufarbeitung Ihres problematischen Verhaltens stattgefunden hat. Nur dann darf er Ihnen eine positive Prognose geben!
Noch eine wichtige Empfehlung:
Immer wieder thematisieren meine Klienten die Frage nach Wahrheit und Lüge bei der MPU. Ich möchte deshalb auch dazu was sagen:
- Schauen Sie sich unbedingt Ihre Führerscheinakte sehr genau an. Von dem, was dort drin steht, dürfen Sie nicht abweichen, denn sonst ist Ihnen das negative Gutachten sicher. Es kommt gar nicht so selten vor, dass in der Führerscheinakte etwas gelandet ist, das nicht der Wahrheit entspricht. Da hilft aber alles nichts: Widerspruch zur Aktenlage führt zwingend zum negativen Gutachten. Um das zu vermeiden, müssen Sie an dieser Stelle also tatsächlich lügen!
- Voltaire hat gesagt: Alles, was du sagst, soll wahr sein. Aber nicht alles Wahre sollst du auch sagen. - Was soll das bedeuten? Sie sollten keine Plaudertasche sein. Wonach Sie nicht gefragt werden, das sprechen Sie von sich aus tunlichst nur dann an, wenn Sie das zusammen mit mir vorher genau geplant haben.
12. Warum sind Sie hier?
Das ist eine oft gestellte Einstiegsfrage bei der MPU. Es ist keine Smalltalk-Frage, sondern der Gutachter bekommt durch Ihre Antwort bereits einen wichtigen ersten Eindruck von Ihrer Vorbereitung.
Was steckt hinter dieser Frage?
Für den Klient ist die Antwort ja naheliegend: "Na, weil ich den Führerschein natürlich wieder haben will!" Das ist aber eh klar und banal. Hören möchte der Gutachter stattdessen ungefähr folgendes:
Er will also eine kurze Erklärung hören, dass Sie verstanden haben, dass Ihr Verhalten eine besondere Gefahr war. Wenn Sie jetzt keine erhöhte Gefahr mehr sind, wird man Sie auch wieder fahren lassen.
13. Warum eine künstliche »Story« auswendig lernen kein guter Weg ist
"Mit einer guten Story besteh ich die MPU ganz easy!" Das hör ich immer wieder. Es ist eines der nicht auszurottenden Gerüchte. Schauen wir uns also genauer an was davon zu halten ist.
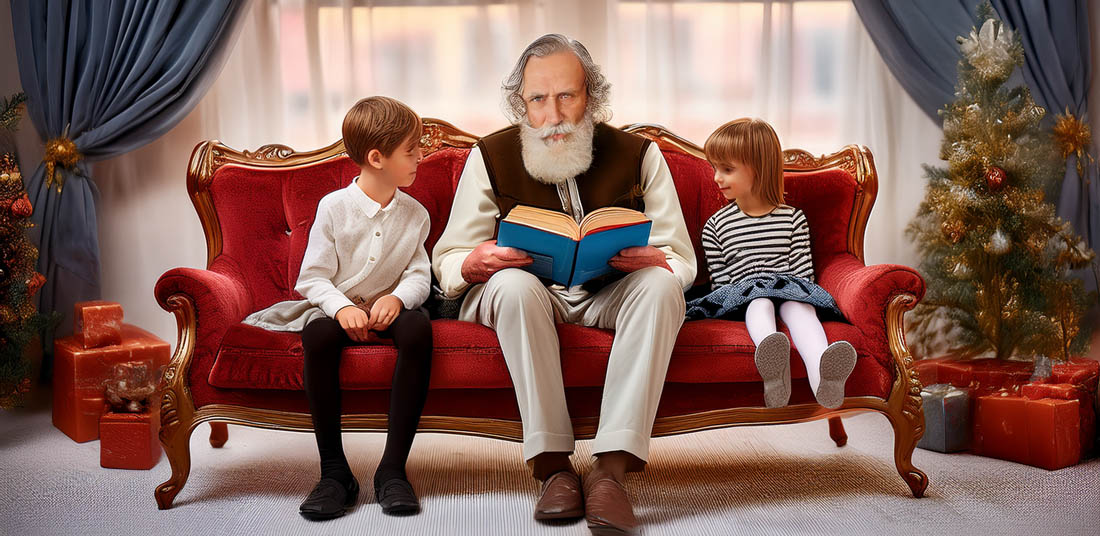
Die Ausgangssituation
- Der Gutachter kennt Sie nicht. Er sieht Sie zum ersten Mal. Von Ihrem Fall weiß er genau, was in Ihrer Führerscheinakte steht - nicht mehr und nicht weniger.
- Sie müssen ihm nachvollziehbar erklären können, wieso es zu dem problematischen Verhalten gekommen ist, wegen dem Sie jetzt zur MPU müssen.
- Ebenso nachvollziehbar müssen Sie berichten können, welche Veränderungen Sie durchgeführt haben und welche Erfahrungen Sie dabei gemacht haben.
- Dann will er auch noch wissen, wodurch Sie einen drohenden Rückfall rechtzeitig erkennen werden und was Sie vorgesehen haben, um einen solchen Rückfall abfangen zu können.
So lange eine künstliche Story diese Voraussetzungen perfekt erfüllt wird es vermutlich nicht auffallen, dass Sie nur etwas von A bis Z Ausgedachtes präsentieren wollen.
Unterschätzen Sie diese Anforderung aber nicht. Der Gutachter wird sehr genau nachfragen und misstrauisch werden, wenn ihm etwas nicht stimmig vorkommt. Wenn Sie dann eine Antwort schuldig bleiben müssen, befinden Sie sich bereits deutlich auf dem Weg zur negativen Prognose.
Wie die "Story-Methode" funktioniert
Man greift auf eine entsprechend vorbereitete Geschichte zurück. Oft sind das sehr allgemein gehaltene Themen, weil sie ja möglichst universell passen sollen. Man lernt eine solche fiktive Geschichte auswendig und spielt durch, wie man auf bestimmte zu erwartende Nachfragen reagieren sollte.
Hört sich doch gar nicht so schlecht an, oder? Es können so keine überraschenden Fragen kommen und mir kann nix mehr passieren!
Überlegen Sie mal:
- Der Gutachter macht seinen Job nicht erst seit gestern. Was glauben Sie wohl, wie oft er solche meistens mehr schlecht als recht zusammengebastelte Stories präsentiert bekommt?
- Glauben Sie wirklich, es fällt ihm nicht auf, wenn er schon zum so-und-so-vielten Mal die gleiche Story zu hören bekommt, bei der lediglich Namen und Daten ausgetauscht sind?
Wem nützt die Story-Methode?
Nur den MPU-Vorbereitern, die damit arbeiten! Sie haben nur wenig Arbeit und lassen sich das auch noch königlich bezahlen von denjenigen Dummen, die dem Gerücht auf den Leim gegangen sind, dass das eben die einzig zuverlässige Art der Vorbereitung wäre. Angeblich darf man nämlich auf keinen Fall sagen was wirklich war…
Dazu kommt oft noch, dass einem das eigene Verhalten peinlich ist und man nicht offen drüber reden mag. Man nimmt deshalb gern ein solches Angebot an, mit dem man sich hinter was scheinbar Harmlosem verstecken kann.
Und die Wahrheit?
Die Wahrheit ist einfacher als Sie wahrscheinlich denken werden:
- Der Gutachter geht von vorne rein davon aus, dass Sie sich "allerhand geleistet" haben im Straßenverkehr, denn sonst wären Sie ja jetzt nicht bei der MPU. Deshalb ist es völlig unnötig und meistens sogar kontraproduktiv, wenn Sie sich bemühen alles zu glätten und verharmlosen.
- Wenn Sie bei der ungeschönten Wahrheit bleiben, besteht keine Gefahr, dass Sie sich verplappern könnten (wie bei einer Story).
- Den Gutachter interessiert ja der Hintergrund für Ihr Verhalten. Wenn Sie den in einer vernünftigen MPU-Vorbereitung sauber aufgearbeitet haben, brauchen Sie auch keine Angst vor intensiven Nachfragen haben. Eine auswendig gelernte Story kann das nicht leisten.
- Wenn Sie nicht gerade der geborene Schauspieler sind braucht eine vernünftige Aufarbeitung des wirklich stattgefunden Falls meistens sogar weniger Zeit als das sichere Antrainieren einer ausgedachten Story.
Ich rate Ihnen:
Fallen Sie auf diese alte Masche nicht rein! Davon angesprochen werden vor allem Leute, die hoffen, es würde so etwas wie ein "Patentrezept" geben. Oft wird unter der Hand auch noch angedeutet, man hätte da Kontakt zu einem ganz bestimmten Gutachter…
Das lässt man sich extra bezahlen - ganz genau wissend, dass Sie ja hinterher nicht kommen können und sich beklagen, dass es leider nicht geklappt hat. Etwas verbindlich Schriftliches gibt es dafür ja meistens nicht.
14. Du sollst nicht merken…
Therapie durch die Hintertür: Darf Ihr Verkehrstherapeut entscheiden wohin die Therapie führen soll ohne Ihre Zustimmung? Und Sie zahlen auch noch dafür?
Es gibt eine große Zahl unterschiedlicher therapeutischer Ansätze. Sogar für einen Fachmann ist es schwer den Überblick zu behalten. Die weit überwiegenden Angebote rund um die MPU folgen einem lernpsychologischen Konzept. Das ist auch sinnvoll, weil der MPU-Gutachter selber so arbeiten muss. Trotzdem finden sich noch ganz erhebliche Unterschiede. Einen ganz speziellen Ansatz möchte ich hier herausgreifen und näher unter die Lupe nehmen.
Ein besonderer Ansatz
Manche Psychologen sind fest davon überzeugt, dass Verhalten besser und nachhaltiger beeinflusst werden kann, wenn der Klient glaubt er sei selber drauf gekommen. Man versucht deshalb den Klient so trickreich zu manipulieren, dass er gar nicht bemerkt, dass er einer Beeinflussung von außen gefolgt ist.
Mein erster Gedanke ist, dass ich doch stark bezweifle, dass der Klient wirklich nichts davon bemerkt, dass er irgendwo hin dirigiert wird. Ich vermute viel eher, dass der Therapeut glauben möchte ein so begnadeter "Magier" zu sein, dass seine Manipulationsversuche unsichtbar bleiben.
Würde es Ihnen wirklich gefallen von Ihrem Gegenüber "von oben herab" betrachtet und dirigiert zu werden? Auch MPU-Klienten sind erwachsene Menschen - oder nicht?
15. Warum professionelle Vorbereitung der optimale Weg ist
Die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) ist eine große Hürde. Viele Betroffene unterschätzen, wie umfangreich die Vorbereitung ist – und scheitern, obwohl sie es hätten verhindern können.
Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie rechtzeitig verstehen, was auf Sie zukommt und welche Schritte jetzt wirklich wichtig sind.
Nicht den Kopf in den Sand stecken
Ihr Führerschein ist wichtig – beruflich wie privat. Geben Sie ihn nicht auf, nur weil Sie sich allein gelassen fühlen. Ich zeige Ihnen, wie Sie sicher und selbstbewusst in die MPU gehen!

Informieren Sie sich über alle wichtigen Einzelheiten und stellen Sie alle Fragen, die Ihnen Kopfzerbrechen bereiten!
Warum frühzeitige Information so entscheidend ist
Eine MPU ist keine Formsache. Sie prüft nicht nur Fakten, sondern vor allem:
- Ihr Verhalten,
- Ihre Einsicht,
- Ihre Veränderungen,
- und Ihre Zukunftsstrategie.
Ohne eine gute Vorbereitung wirkt Ihre Geschichte oft unvollständig, unsicher oder unglaubwürdig – und das führt schnell zu einem negativen Gutachten.
Frühzeitig informiert zu sein bedeutet:
- weniger Stress
- mehr Klarheit
- bessere Chancen
- kein Geldverlust durch Wiederholungs-MPUs
In meinem unverbindlichen Erstgespräch erhalten Sie:
- eine ehrliche Einschätzung Ihrer persönlichen Situation
- Infos darüber, was der Gutachter wirklich prüft
- Hinweise zu Ihren individuellen Anforderungen (z. B. Alkohol, Drogen, Punkte, Straftaten)
- klare Empfehlungen für die nächsten Schritte
- Antworten auf alle Ihre Fragen
Meine kostenlose Erstberatung dauert ca. 45 Minuten und findet bequem per Videokonferenz statt – ohne Anfahrt, ohne Aufwand.
16. Anspruch und Wirklichkeit der MPU
Zweck der MPU ist es zu überprüfen, ob Sie sich so weit geändert haben, dass Sie jetzt keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer mehr darstellen. Der Gutachter sieht Sie an dem Tag zum ersten Mal. Für die Begutachtung hat er nur eine Stunde Zeit. Ist das realistisch?
Was trifft zu?
Sehr oft ist zu hören, dass von Betroffenen die MPU als extrem ungerecht und willkürlich empfunden wird. Von der anderen (offiziellen) Seite wird die Einrichtung MPU als etwas mustergültig Überwachtes und eben gerade nicht Willkürliches verkauft. Das sind zwei Sichtweisen, die weiter kaum auseinander liegen könnten. Ich möchte deshalb in diesem Beitrag genauer hinsehen und untersuchen, wie die Wirklichkeit aussieht.
Unbestreitbar ist, dass es Verkehrsteilnehmer gibt, die durch ein besonders problematisches Verhalten ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko darstellen und dass davon auch Unbeteiligte betroffen sein können. Oft sind solche "Problem-Fahrer" bereits auffällig geworden und bestraft worden.
Grenzen sind definiert:
Zur Alkohol-MPU beispielsweise kommt es zwingend dann, wenn man als Verkehrsteilnehmer 1,60 ‰ oder höher erreicht hat oder Wiederholungstäter Alkohol ist. Zur Punkte-MPU kommt es bei Erreichen von 8 Punkten usw.
Es gibt zwar eine ganze Reihe von Sonderfällen (eine Alkohol-MPU kann man sich z.B. unter bestimmten Voraussetzungen auch bereits mit 1,1 ‰ "einfangen"), aber die oft behauptete Willkür hält sich doch stark in Grenzen.
Die Gefahrenabwehr
Es dürfte schon klar geworden sein, dass der angestrebte Sinn der MPU in der Abwehr besonderer Gefahren für die Allgemeinheit im Straßenverkehr liegt. So allgemein formuliert ist dagegen sicher nichts zu sagen. Wie so oft, steckt der Teufel aber im Detail.
Zur MPU kommt es ja erst, wenn sich einer bereits entsprechend drastische Auffälligkeiten geleistet hat. In der Praxis läuft es meistens darauf hinaus, dass schon etwas geschehen ist, das die Führerscheinstelle als erhebliche Gefährdung erkennen konnte. Die Aufgabe der MPU besteht jetzt darin, dass kompetente Fachleute (ein Verkehrsmediziner und ein psychologischer MPU-Gutachter) den Klienten mit seinem individuellen Fall genau unter die Lupe nehmen mit dem Ziel, dass sie eine verbindliche Aussage machen müssen, ob er in Zukunft weiterhin ein gefährlicher Verkehrsteilnehmer wäre - oder ob er sich eben entsprechend geändert hat, dass man ihn jetzt wieder auf die Allgemeinheit loslassen kann.

Die Technik des Handlesens hat sich bei der MPU nicht durchsetzen können.
Eine abgesicherte Prognose
An dieser Stelle wird es verdammt schwierig. Prognosen sind ja bekannt dafür, dass sie manchmal erstaunlich weit daneben liegen können. Je zuverlässiger eine Prognose sein soll, um so weiter steigt der dafür nötige Aufwand. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer: Es wäre unrealistisch den Aufwand so hoch zu schrauben, dass eine kaum mehr zumutbare zeitliche, psychische und finanzielle Belastung für den Klient entstehen würde. Das finde ich auch völlig nachvollziehbar.
Das Problem ist, dass eine "Begutachtung light" zwar eine gewisse Tendenz aufzeigen kann, aber bestimmt keine belastbare Prognose liefern würde. Man hat deshalb nach einem praktikablen Kompromiss gesucht. Im Fall der MPU sieht der folgendermaßen aus:

Hier liegt der Hase im Pfeffer: Der Aufwand soll in realistischen Grenzen liegen und trotzdem eine treffsichere Prognose erreicht werden.
Der Lösungsversuch
Eine umfangreiche Expertengruppe zur Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung befasst sich mit diesem Problem und hat Beurteilungskriterien ausgearbeitet, die laufend weiter entwickelt werden. Sie sind gewissermaßen die "Bibel" für den MPU-Gutachter. Die Absicht dabei war es ein recht detailliertes Grundgerüst zu schaffen, innerhalb dessen die MPU erfolgen muss. Man wollte dadurch den zusätzlichen Unsicherheitsfaktor unterschiedlicher Arbeitsweise der einzelnen Gutachter beseitigen, was auch zu einem guten Teil gelungen sein dürfte. Die Hoffnung dabei war natürlich, dass die Qualität der Prognose steigt.
Prognose oder Momentaufnahme?
Ich greife nochmals das Beispiel Alkohol heraus. Die Statistik zeigt, dass von allen Fahrerlaubnisinhabern, die wegen Alkohol auffällig geworden sind, bei einer Auswertung 5 Jahre später jeder Dritte schon wieder rückfällig geworden ist. Ich meine, dass diese Zahl für den Anspruch einer Prognose dann doch sehr ernüchternd ist.
Die Realität sieht also so aus, dass die MPU vielleicht eine ganz gute Momentaufnahme liefern mag, vom hoch gesteckten Ziel einer belastbaren weit in die Zukunft reichenden Prognose aber weit entfernt ist. Daran ändern auch Expertenkommission und zwingend vorgegebene Beurteilungskriterien nichts.

Der Blick in die Zukunft war schon immer schwierig. Dieses Problem lösen auch keine noch so ausgefeilten Begutachtungskriterien.
Licht- und Schattenseiten
Ich meine, es ist unübersehbar, dass die MPU das nicht einlösen kann, womit sie nach außen hin ja antritt: eine solide untermauerte Prognose über das künftige Verhalten der Klienten abzugeben. Ich finde, bei einer so hohen 5-Jahres-Rückfallquote wird einfach der eigene Anspruch viel zu wenig erfüllt.
Zur Vermeidung von Missverständnissen: Ich sage nicht, dass die MPU überhaupt nichts bringt. Sie hat eine positive Auswirkung auf die Reduzierung der Unfallzahlen. Allerdings klaffen der Anspruch und die Realität doch recht weit auseinander.
Bei aller Kritik und Ablehnung der MPU gegenüber sollte man aber einen wesentlichen Vorteil nicht übersehen: Die Beurteilungskriterien sind für jeden MPU-Gutachter wirklich verbindlich. Die so oft behauptete Willkür bei der MPU ist viel, viel geringer als es den Betroffenen erscheint. Warum das so ist? Ganz einfach: Die meisten Betroffenen kennen halt die Beurteilungskriterien nicht mal ansatzweise. Viele wissen nicht einmal, dass sie existieren! Wer so zur MPU antritt, der gleicht einem, der zu einer Schachpartie antritt, aber nicht mal weiß wie die Figuren ziehen dürfen. Auf die MPU bezogen: Die scheinbare Willkür steckt in Wirklichkeit zu mindestens 90 Prozent im Nicht-Kennen ganz wesentlicher Voraussetzungen.
Was folgt daraus?
Die gute Nachricht: Das Bestehen der MPU ist nicht davon abhängig, ob dem Gutachter Ihre Nase gefällt oder nicht. Es gibt ganz bestimmte Voraussetzungen und Regeln, die erfüllt sein müssen - dann steht dem positiven Ergebnis nichts mehr im Weg.
Die weniger angenehme Nachricht: Diese Voraussetzungen sehen genau betrachtet je nach dem individuellen Fall unterschiedlich aus. Was beim einen Kandidat gereicht hat, kann beim anderen zum negativen Gutachten führen. Die Grundlage sind die Beurteilungskriterien. Die muss man sich aber eher wie eine Art "Filter" vorstellen, durch den der Gutachter Ihren Fall betrachtet. Und weil das eine Menge Tücken und Fallstricke enthalten kann, deshalb ist es eine schlechte Idee ohne eine professionelle Vorbereitung zur MPU anzutreten.
17. Ich sag einfach die Wahrheit, dann kann mir nix passieren…
Die Wahrheitsfindung ist bereits abgeschlossen. Jetzt geht es um etwas ganz Anderes. Sie haben durch Ihr Verhalten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Gutachter muss überprüfen, ob das jetzt nicht mehr der Fall ist. Sie müssen den Gutachter überzeugen können, dass Sie auch in Zukunft nicht in das alte gefährliche Verhalten zurück fallen werden.
Beachten Sie:
Was genau vorgefallen ist, das kann der Gutachter ja in der Führerscheinakte nachlesen. Er möchte von Ihnen aber erfahren, warum Sie sich so verhalten haben. Ohne eine solide Aufarbeitung werden Sie das aber kaum überzeugend erklären können!
Ziel der MPU ist es, für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen und diejenigen aus dem Verkehr zu ziehen, die durch ihr Verhalten eine besondere Gefahr darstellen. Dass Sie zu dieser Problemgruppe gehören, daran ist nicht mehr zu rütteln, denn sonst würden Sie ja jetzt nicht zur MPU müssen - so die Logik, gegen die Sie nicht angehen dürfen. Das, was die meisten Kandidaten unter "die Wahrheit sagen" verstehen, beschränkt sich auf bereuen und schöne Vorsätze.
Der MPU-Gutachter soll ja eine Prognose abgeben. Dafür muss er einschätzen können, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie auch in Zukunft bei Ihrem gefährlichen Verhalten bleiben werden. Reue und schöne Vorsätze sind da kein brauchbares Kriterium, weil ja kaum jemand kommen wird und erklären: "Doch, ich werde das auch in Zukunft so machen!"
Unterschied Gerichtsverhandlung ⇔ MPU
I. Vor Gericht
Der Richter muss herausfinden was passiert ist und in welchem Kontext. Sein Ziel ist es die Schuld zu ergründen und darauf aufbauend dann sein Urteil zu sprechen, das meistens eine mehr oder weniger drastische Strafe bedeutet. Insofern spielt Wahrheit bei der Arbeit des Richters eine recht wichtige Rolle.

Urteil oder Strafbefehl liegt bereits hinter Ihnen, wenn Sie zur MPU antreten.
II. Bei der MPU
Die Aufgabe des MPU-Gutachters ist aber eine grundlegend andere: Ihn interessieren Fragen wie Schuld und Strafe nicht im geringsten. Sein Job ist die Fahreignungsbegutachtung - nicht nur ein Wortungetüm, sondern eine durchaus komplexe Aufgabe. Zweck der Begutachtung ist es herauszufinden, ob Sie weiterhin eine besondere Gefahr darstellen für andere Verkehrsteilnehmer. Falls ja, dann gelten Sie als ungeeignet zur Teilnahme am Straßenverkehr und erhalten eine negative Prognose.
Handlungsgründe sind gefragt
Statt Versprechungen interessieren den Gutachter die Gründe für Ihr problematisches Verhalten. Egal ob das jetzt eine Fahrt unter Akohol- oder Drogeneinfluss war, hartnäckige Geschwindigkeitsüberschreitungen oder was auch immer: Man kann davon ausgehen, dass Ihnen die Regeln bekannt waren und Sie haben dagegen verstoßen. Sehr wahrscheinlich nicht nur einmal. Es muss also zuerst untersucht werden warum Sie das getan haben.
Sie werden bei der MPU nicht an einen Lügendetektor angeschlossen. Was vorgefallen ist, das steht ja sowieso in der Führerscheinakte. Der Gutachter erwartet von Ihnen aber die sorgfältige Aufarbeitung, warum es dazu kam. Er vermutet für Ihr Verhalten handfeste Hintergründe, die oft in ganz anderen Bereichen Ihres Lebens liegen können. Antworten nur an der Oberfläche helfen Ihnen nicht weiter!
Veränderungen sind nötig
Eine positive Prognose können Sie nur dann bekommen, wenn Sie nicht einfach nur behaupten, dass Sie's nicht wieder tun werden. Warum sollte der Gutachter Ihnen das glauben? Sie hätten schließlich schon lange Ihr Verhalten ändern können, dann müssten Sie jetzt nicht zur MPU. Deshalb will er entscheidende Änderungen in dem Lebensbereich geboten bekommen, der vorher bei der Frage nach den Handlungsgründen der problematische Bereich war.
Sie sehen also, dass auch das gut vorbereitet sein muss, damit Sie überzeugend wirken können, denn das ist nötige Voraussetzung für eine positive Prognose.
